Kleinwuchs – Ursache und Diagnose
Von Kleinwuchs spricht man, wenn ein Mann bzw. eine Frau nach vollständigem Wachstum eine Körperlänge unter 1.5 bzw. 1.4 Metern aufweist. Die Ursachen für Kleinwuchs sind vielfältig. Sie können genetischen, chromosomalen, ernährungsbedingten oder auch psychosozialen Ursprung haben. Genauso vielfältig sind auch die Diagnoseformen.
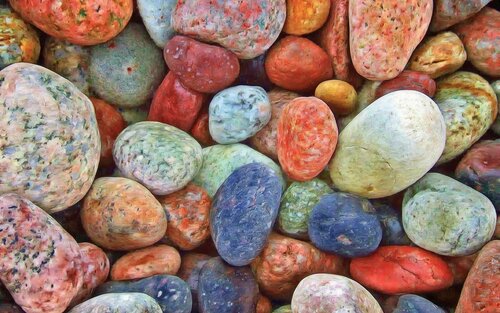
Die Ursachen und Diagnoseansätze von Kleinwuchs sind sehr unterschiedlich. (pixabay)
Definition von Kleinwuchs
Kleinwuchs, auch Mikrosomie, ist die Bezeichnung für Menschen mit einem unterdurchschnittlichen Körperlängenwachstum. Von Mikrosomie betroffen gelten diejenigen Personen, deren Körpergrösse unterhalb des dritten Perzentils liegt. Das bedeutet, dass 97 Prozent der Personen gleichen Geschlechts und Alters eine grössere Körperlänge aufweisen. Bei Erwachsenen gelten nach europäischen Körpermassen Männer bzw. Frauen mit einer vollständig ausgewachsenen Körpergrösse unter 1,5 bzw. 1,4 Meter als kleinwüchsig. In der Schweiz leben ungefähr 4000 Menschen mit Mikrosomie.
Diskussionen in der Community
Varianten und Ursachen
Familiärer Kleinwuchs
Die Ursachen von Kleinwuchs sind vielfältig. Der familiäre Kleinwuchs (primärer Kleinwuchs) ist die häufigste Ursache von Kleinwuchs. Er ist nicht durch eine Krankheit, sondern durch die genetische Veranlagung ergründet.
Konstitutionelle Entwicklungsstörung
Die konstitutionelle Entwicklungsstörung ist die zweithäufigste Variante von Kleinwuchs, erblich bedingt und kommt vor allem bei Jungen vor. Betroffene sind sogenannte «Spätzünder» und kommen später als ihre Altersgenossen in die Pubertät, wodurch sich auch deren Wachstumsschub verzögert. Die Endgrösse nach Abschluss der Wachstumsphase liegt bei den Betroffenen jedoch im Normalbereich.
Intrauteriner Kleinwuchs
Von intrauterinem Kleinwuchs spricht man, wenn das Kind bereits kleinwüchsig zur Welt kommt. Dies kann auf verschiedene Faktoren während der Schwangerschaft zurückgeführt werden, wie beispielsweise Drogenmissbrauch (Rauchen, Alkohol- und Medikamentenkonsum) während der Schwangerschaft. Auch eine gestörte Funktion des Mutterkuchens kann eine Ursache für intrauteriner Kleinwuchs sein. Die meisten Kinder können den Wachstumsrückstand innerhalb der ersten zwei Lebensjahre aufholen, andere bleiben kleinwüchsig.
Chromosomale Störungen und syndromale Erkrankungen
Bestimmte Störungen, die zu einer veränderten Chromosomenanzahl oder zu Fehlern im Erbgut führen, können unter anderem Mikrosomie als Begleiterscheinung aufweisen. Beispielsweise haben Menschen, die vom Down-Syndrom (Trisomie 21) betroffen sind oder das Ulrich-Turner-Syndrom aufweisen, eine chromosomale Störung, bei welcher Kleinwuchs oftmals als Begleiterscheinung auftritt.
Auch syndromale Erkrankungen, wie das Noonan-Syndrom, Silver-Russel-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom oder das DiGeorge-Syndrom sind komplexe Krankheitsbilder, bei denen Kleinwüchsigkeit ein Symptom neben vielen anderen darstellt.
Skelettdysplasien
Bei Skelettdysplasien kommt es zu einer Störung im Knorpel- und Knochenwachstum. Die häufigsten Formen von Skelettdysplasien sind die Achondroplasie und Hypochondroplasie. Sie zählen zu den häufigsten Ursachen von Kleinwuchs. Bei Betroffenen ist der Rumpf meist «normal» lang, während ihre Extremitäten aufgrund des gestörten Längenwachstums der Röhrenknochen verkürzt sind.
Eine weitere Form von Skelettdyplasie, die oftmals mit Kleinwüchsigkeit einhergeht, ist Osteogenesis imperfecta (Glasknochenkrankheit). Je nach Schwere der Erkrankung können die zahlreichen Knochenbrüche zu Deformationen und Kleinwuchs führen.
Endokrine Erkrankung
Kleinwuchs kann auch auf hormonelle Störungen zurückgeführt werden. So können ein Mangel an Somatotropin (Wachstumshormon), einer Schilddrüsenunterfunktion oder aber auch Diabetes mellitus zu Kleinwuchs führen. Diese hormonellen Störungen sind jedoch meist gut behandelbar, sodass Betroffene oft eine «normale» Körperlänge erreichen können.
Eine weitere hormonelle Störung, die zu Kleinwuchs führen kann, ist das Cushing-Syndrom, bei welchem eine zu hohe Dosis an Cortisol im Körper der Betroffenen vorliegt.
Fehlernährung (Malnutrition)
Ohne eine ausreichende und ausgewogene Ernährung kann kein normales Wachstum stattfinden. In Drittweltländern, wo das Nahrungsangebot knapp ist, ist Unterernährung eine häufige Ursache für Kleinwuchs. In Europa, wo das Nahrungsangebot zwar meist ausreichend ist, kann jedoch eine chronische entzündliche Erkrankung des Darms eine Malabsorption von Nährstoffen verursachen, sodass für das Wachstum wichtige Nährstoffe nicht durch den Darm aufgenommen werden können. So können Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie bei einer dauerhaften Malabsorption während der Wachstumsphase Kleinwuchs als Folge haben.
Organische und metabolische Ursachen
Erkrankungen an verschiedenen Organen, wie Lunge, Herz, Leber, Darm und Nieren können zu Störungen im Kohlenhydrat-, Fett-, Protein- oder auch Knochenstoffwechsel führen und eine Kleinwüchsigkeit ergründen.
Psychosoziale Ursachen
Kleinwuchs kann auch psychosoziale Ursachen haben. Wenn ein Kind unter psychischer Vernachlässigung leidet, kann die zu Mikrosomie führen, wobei dieser Rückstand im Wachstum wieder aufgeholt werden kann, wenn sich die psychosozialen Umstände rechtzeitig verbessern. Diese von Vernachlässigung wird auch Psychische Deprivation genannt. Es können aber auch andere psychische Ursachen, wie eine Essstörung oder eine Depression zu Kleinwuchs führen.
Diagnose
Wenn bei einem Kind faktischer Kleinwuchs vorliegt, wird durch eine Röntgenaufnahme der linken Hand des Kindes die erwartete, vollständig ausgewachsene Körpergrösse ermittelt. Dabei kann festgestellt werden, ob die Mikrosomie genetisch bedingt ist oder mit einer Erkrankung oder einem Mangel in Zusammenhang steht.
Da die Ursachen von Mikrosomie vielfältig sein können, sind auch die Diagnostikansätze sehr unterschiedlich. Um die Ursache des Kleinwuchses zu ermitteln, können beispielsweise folgende Ansätze der Diagnostik verfolgt werden:
- Messung der Körpergrösse von Eltern und Geschwistern, um zu erkennen, ob die Mikrosomie erblich bedingt ist
- Befragung der Eltern, ob es bei ihnen zu verspäteten Einsetzen der Pubertät kam
- Suche nach weiteren Symptomen, die mit chromosomalen Störungen oder syndromalen Erkrankungen zusammenhängen könnten
- Analyse des Skeletts auf etwaige Disproportionen
- Bestimmung der Hormonkonzentrationen im Blut und eventuelle zusätzliche Hormontests zur Feststellung eines Überschusses bzw. Mangels an Wachstumsrelevanten Hormonen
- Stoffwechselspezifische Diagnostik zur Feststellung allfälliger Störungen des Stoffwechsels
- Bei Kindern: Messung des Körpergewichts und des Body-Mass-Index (BMI) sowie genaue Analyse der Ernährung, um eine allfällige Mangel- oder Falschernährung zu erkennen
- Bei Kindern: Beobachtung der Interaktion zwischen Eltern und Kind sowie Beurteilung der psychosozialen Situation des Kindes

